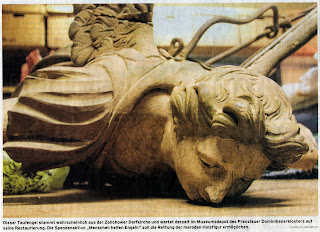Bernhard Manke traf mit Jesus in Jerusalem ein. Es war Palmsonntag, tausende Pilger machten sich vom Ölberg auf den Weg in die Altstadt, um mit Trommeln und Fanfaren die Ankunft des Messias zu feiern. Jesus war seinerzeit auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten, Bernhard Manke erreichte die Stadt mit dem Flughafenshuttle aus Tel Aviv. Neben ihm saßen Rainer und Doris Kleinschmidt, Mario und Andrea Büchner sowie seine Frau Stefanie im Kleinbus. Sie kannten sich alle seit Schulzeiten, nur Doris, Rainers zweite Ehefrau, war erst vor fünf Jahren zu ihrer Gruppe gestoßen. Das Wetter war gut, beinahe 20 Grad wärmer als in Berlin, wo es heute Morgen kleine Eisflocken geregnet hatte. Manke sah aus dem Fenster und versuchte, sich zu entspannen.
Das war nicht leicht für ihn. Er war ein strikter Gegner dieser Reise gewesen. Von Anfang an.
Auf der Höhe des Damaskustores geriet ihr Shuttle in einen Zug dunkelhäutiger Dudelsackpfeifer. Bernhard Manke kam das verdächtig vor, Dudelsackpfeifer mit olivfarbener Haut und schwarzen Augen. Sie steckten in weißen Umhängen, die mit christlichen Symbolen bedruckt waren. Die Gefahr näherte sich in überraschenden Verkleidungen, dachte Manke. Die Welt war kompliziert.
Doris strahlte.
„Palmsonntag in Jerusalem. Besser hätten wir das gar nicht planen können“, rief sie. Hätten sie nicht das Gepäck im Wagen gehabt, sie wäre sofort ausgestiegen, um sich unter die falschen Schotten zu mischen. So trafen sie sich zwanzig Minuten nach ihrer Ankunft in der Lobby des Hotels.
Bernhard Manke reiste ungern in Gruppen. Gruppen zwangen ihn, Dinge zu tun, die er nicht tun wollte. Er hätte gern ein wenig auf dem Bett gelegen und später vielleicht ein Bier getrunken. Langsam ankommen. Heute Morgen waren sie noch in Spandau gewesen, auf einem anderen Kontinent. Rainers erste Frau Liane war eher nach seinem Geschmack gewesen, eine Triefnudel vor dem Herrn. Die lahme Liane, so hatten sie sie schon in der Schule genannt. Doris aber riss die Dinge an sich, vielleicht wollte sie so den Vorsprung aufholen, den Andrea und Stefanie in der Gruppe besaßen. Doris hatte keine Kinder und kam ursprünglich aus Kaiserslautern.
Die Israel-Reise war ihre Idee gewesen. Auf Rainers 44. Geburtstag hatte sie damit angefangen, sehr spät, Bernhard war zu betrunken gewesen, um den Ernst der Lage zu verstehen. Sie hatten ja bisher höchstens mal ein Wochenende zusammen verbracht und waren dabei nie weiter als Timmendorf gekommen. Als Bernhard das nächste Mal von ihrem gemeinsamen Urlaub hörte, ging es schon um die Flüge. Sie mussten sich beeilen, weil die Preise sonst stiegen, sagte Stefanie, seine Frau. Sie fuhren in den Osterferien, obwohl die Kinder gar nicht mitkamen. Es war zu gefährlich für die Kinder, aber das gab niemand zu. In den Auslandsnachrichten klang es, als würde sich Israel auf einen baldigen Atomkrieg mit dem Iran vorbereiten.
Als Bernhard Manke im vorigen Dezember seinen Chef über seinen bevorstehenden Osterurlaub informierte, sagte der nur: „Oh.“
„Bernhard fährt nach Israel“, verkündete Simmering ein paar Tage später bei einem Mittagessen mit Vogel, der den Geschäftskundenbereich leitete.
„Jetzt?“, fragte Vogel.
„Über Ostern“, sagte Manke.
„Ostern!“, rief Vogel. „Sie haben ja Mut, Manke.“
„Wieso?“.
„Christlicher Feiertag“, sagte Vogel.
„Ach was“, sagte Manke und lächelte spöttisch.
Er erzählte den beiden Kollegen nicht, dass Ostern in diesem Jahr mit Pessach zusammenfiel, dem hohen jüdischen Feiertag, und auch nicht, dass er im Verlauf der Reise die ägyptische Grenze überqueren würde.
Vier Tage Rotes Meer. Ein Vorschlag von Doris, die auch eine Unterkunft namens Big Dune organisiert hatte. Bei einem Abendessen der drei reisenden Paare im Februar hatte Bernhard die anderen daran erinnert, dass im vorigen September ein paar Amerikaner hinter der Grenze entführt worden waren.
„Ja, aber das waren Amerikaner, Bernhard“, sagte Andrea, als würden Entführer die Pässe ihrer Opfer kontrollieren, bevor sie sie verschleppten. Doris zeigte Bilder vom Big Dune. Man sah Meer, Sand, sonnenverbannte Menschen und bunte Tücher, die im Sommerwind wehten.
„Yves hat auch immer ein bisschen was zu rauchen da“, flüsterte Doris.
„Yves?“, fragte Bernhard.
„Er ist der Maître vom Big Dune“, sagte Doris.
„Ein wenig die Seele baumeln lassen nach all den Sehenswürdigkeiten in der heiligen Stadt“, sagte Rainer, als betreibe er ein alternatives Reisebüro.
„Seele baumeln lassen?“, fragte Manke.
Niemand lachte. Stefanie und Andrea hatten Erregungsflecken am Hals, wahrscheinlich dachten sie bereits an Yves.
Bernhard Manke rief den Sportchef der dpa an, dessen Aktiendepot er seit Jahren betreute. Er war der einzige Journalist, den er kannte.
Er wollte Hintergrundinformationen aus dem Sinai. Der Sportchef erkundigte sich im Auslandsressort und rief mit der Information zurück:
„Die Beduinen spinnen gerade.“
„Die Beduinen“, sagte Manke.
„Na ja, wenn ich das richtig verstehe, betreiben die diese Camps, die hinter der Grenze zum Sinai sind. Kamele, Führungen, Hasch. Pipapo. Zuletzt haben sie ein paar Koreaner am Katarinenkloster entführt“, sagte der Sportchef.
„Wie gehts denn den Koreanern?“, fragte Manke.
„Weiß nicht“, sagte sein Kontakt bei der Deutschen Presseagentur. „Das scheint alles ziemlich unübersichtlich zu sein. Es gibt verschiedene Stammesfürsten, und mit den Ägyptern sind die sich auch nicht grün. Jeder gegen jeden. Halten Sie sich von den Beduinencamps fern, Herr Manke.“
„Jeder gegen jeden“, sagte Manke.
„So siehts aus“, sagte der Sportchef.
Kamele, Hasch, Pipapo. Mit anderen Worten: Yves. Bernhard dachte an die wehenden bunten Tücher auf Doris’ Fotos. Wenn er sich richtig erinnerte, hatte Doris preiswerte Beduinentaxis erwähnt, die sie von der Grenze zum Big Dune fahren würden. Big Dune klang ja geradezu, als sei es das Herz der Beduinenwelt.
Er googelte das Camp, fand ein Amateurvideo, auf dem man die Füße des offensichtlich bekifften Kameramannes sah und ein Stück Meer. Dazu summte jemand aus dem Off die Melodie von „Somewhere over the Rainbow“. Vier Leute mochten das Video, fünf nicht.
„Die Beduinen spinnen gerade“, sagte Bernhard seiner Frau beiläufig beim Abendessen. „Interessant“, sagte sie. „Interessant? Wir fahren dorthin, Steffi.“
„Nun reg’ dich mal nicht so auf, Bernie“, sagte Stefanie. „Es sind ja noch zwei Monate bis Ostern.“
Die dürren Warnungen des Auswärtigen Amtes waren nichts, womit man Doris, Rainer, Mario und Andrea hätte überzeugen können, die Reise abzublasen. Die Beamten rieten halbherzig von Ausflügen ins Grenzgebiet ab. Gaza-Streifen, Golan-Höhen meiden, Augen auf in Jerusalem. Das schien alles seit Jahrzehnten nicht mehr aufgefrischt worden zu sein.
In den Zeitungen las Manke zuerst den außenpolitischen Teil. Er verstand nicht, wieso die Israelis ein so großes, verrücktes Land wie den Iran angreifen wollten. Das war doch Wahnsinn. Aber niemand schien sich wirklich Sorgen zu machen. Am Tag vorm Abflug war er noch einmal in ihr Reisebüro gegangen, um den Voucher für ihren Mietwagen abzuholen. Frau Speicher saß dort vor der Katalogwand, lächelnd und ahnungslos. Er fragte beiläufig nach der Situation im Sinai.
„Ich glaube, da ist alles ruhig. Es geht doch wohl eher um Syrien, Herr Manke.“
„Syrien?“
„Ja, da würde ich jetzt lieber nicht hinfliegen“, sagte Frau Speicher.
Sie kannte den Nahen Osten offenbar nur aus den Nachrichten von rs2.
Auf dem Flughafen Tegel, Gate 24, war Manke dann bereits den ersten beiden Terrorverdächtigen begegnet. Einer starrte auf den Boden, der andere hatte die Augen geschlossen. Zwei junge, arabische Männer.
Beide wirkten sehr ernst, angespannt.
„Guten Morgen“, sagte Bernhard Manke aufgeräumt, als könne er die Männer durch übertrieben gute Laune in letzter Sekunde von einem Anschlag abbringen. Sie reagierten nicht. Kurz nach dem Start drehte sich Bernhard noch einmal nach den beiden um. Sie schliefen. Bernhard entspannte sich ein wenig, auch weil einer der Männer einen Bart hatte.
Rasierten sich Selbstmordattentäter nicht immer vor der Arbeit?
Im Spiegel las er einen vierseitigen Bericht über die angespannte Lage an den israelischen Grenzen. In Taba, wo sie nach Ägypten einreisen wollten, schien es besonders heiß herzugehen. Die Israelis errichteten dort gerade eine Mauer. Bernhard reichte das Magazin mit hochgezogener Augenbraue weiter zu Rainer. Bitte schön. Er hatte es ja von Anfang an gesagt. Sie saßen alle in Reihe 9. Drei Paare. ABCDEF.
Rainer, der vor 35 Jahren der beste Deutschschüler ihrer Klasse gewesen war, brachte es inzwischen offenbar nicht mehr fertig, sich auf einen vierseitigen Artikel zu konzentrieren. Er starrte zehn Minuten lang auf die erste Seite, blätterte ein bisschen im Sportteil herum, dann reichte er den Spiegel weiter an seine Frau Doris. Sie las ein Essay über den Leistungsdruck von deutschen Schülern. Keiner schien sich für das Land zu interessieren, das sie anflogen.
Die beiden Terroristen wachten erst zur Landung auf. Sie hatten ihren Anschlag verschlafen, dachte Bernhard und lächelte. Er freute sich, dass er noch am Leben war. Ein Wunder.
An ihrem ersten Abend strichen die drei Berliner Paare orientierungslos durch die Altstadt von Jerusalem. Bernhard lief immer ein paar Schritte hinter den anderen, sodass es bei einem Anschlag entweder Steffi oder ihn erwischen würde, nicht aber sie beide. Die Kinder wären keine Vollwaisen. Sie aßen in einem arabischen Restaurant in der Via Dolorosa zu Abend.
„War Dolores nicht die Frau, die Jesus das Schweißtuch reichte?“, fragte Steffi.
„Nein, Stefanie. Das war Veronika“, sagt Rainer und streichelte seine Israelfibel „Unterwegs im Heiligen Land“. „Via Dolorosa heißt: der Leidensweg.“
Steffi wurde rot. Bernhard wäre seiner Frau gern beigesprungen, aber alles, was er über die biblische Geschichte wusste, stammte aus dem „Da Vinci Code“ von Dan Brown. Doris lächelte Rainer so stolz an, als habe er Rom erobert.
Hummus, Lammkoteletts, Oliven. Mario machte ein Riesengewese um das einheimische Bier, das er bestellte. „Local Beer, local Beer!“, rief er dem Wirt zu, bevor der überhaupt ihren Tisch erreicht hatte. Mario redete nie viel, die Bierbestellung war sein Beitrag zur Völkerverständigung. Immer schon. Wenn sie nach Mecklenburg fuhren, bestellte er Lübzer Pils. An der Wand des Restaurants hingen das Bild eines arabischen Generals mit David Niven-Bärtchen und viel Lametta auf der Brust sowie ein Foto des polnischen Papstes auf Jerusalembesuch. Die Grenzen zwischen den verfeindeten Lagern waren schwer zu erkennen. Bernhards dpa-Kontakt hatte recht. Die Lage war unübersichtlich.
Auf dem Rückweg durchs Armenische Viertel starrten sie junge Männer aus den Hauseingängen an, am Zionstor stand eine Gruppe israelischer Soldatinnen, lachend und rauchend, die Uniformen, die Maschinenpistolen wirkten fast pornografisch.
Die Minibar auf dem Hotelzimmer war leer. Auch die Hotelbar war geschlossen. „Pessach“, sagte der Mann an der Rezeption. Sie dürften nur eingeschweißte, koschere Getränke servieren. Bernhard schlief sofort ein. Er träumte, wie er auf dem Pilotensitz einer Air Berlin-Maschine saß. Die Nase des Flugzeuges kippte in die Tiefe. Er drückte auf verschiedene Knöpfe, aber nichts passierte. Die Maschine senkte sich. Bernhard sah zu seinem Copiloten hinüber. Es war der Papst. Zum Frühstück gab es Matze statt Brötchen. Anschließend scheuchte sie Doris wieder durch die Altstadt. Grabeskirche, Felsendom, Klagemauer. Überall Soldaten mit Maschinengewehren. Rainer, seine Israelfibel „Unterwegs im Heiligen Land“ unter den Arm geklemmt, marschierte ihnen voran, den Zeigefinger gereckt wie Lehrer Lämpel.
„Für die Grabeskirche bräuchte man allein einen ganzen Tag“, rief Rainer.
Bernhard Manke stellte sich demonstrativ zu einer amerikanischen Touristengruppe, die von einem israelischen Fremdenführer geleitet wurde, der auf die arabische Welt schimpfte. „Sie behaupten, wir wollen ihre al-Aqsa-Moschee angreifen. Das ist billigste Propaganda. Wir würden uns doch selbst treffen.“
Für den Abend hatte Doris einen Tisch im Barud reserviert, ein Restaurant, das ihr Lonely Planet-Reiseführer empfohlen hatte.
„‚Barud!‘ rufen die Israelis kurz bevor eine Bombe hochgeht“, las Doris aus ihrem Reiseführer vor.
„Was hat das mit dem Restaurant zu tun?“, fragte Bernhard Manke, der spürte, wie die Schlagader an der Innenseite seines Oberschenkels pochte.
Vor vier Jahren, als die Finanzkrise begann und seine Derivate in die Hölle rauschten, war er überzeugt davon, an Hodenkrebs erkrankt zu sein. Aber der Urologe hatte nichts festgestellt. Seine Blutwerte waren nicht so besonders, das Cholesterol im roten Bereich.
Irgendwelche Ablagerungen in der Schlagader dort unten, die sich in Stresssituationen bemerkbar machten. Er griff sich in den Schritt, zuppelte an der Hose, verschaffte sich ein bisschen Luft.
„Hier steht nur, dass es soviel bedeutet wie bei uns: Baum fällt! Ein Warnruf“, sagte Doris.
„Ja, aber wovor wird gewarnt?“, fragte Manke.
„Sag ich doch. Vor der Bombe“, sagte Doris.
„Welche Bombe denn?“, rief Bernhard.
„Nu lass doch mal gut sein, Bernie“, sagte Rainer. „Doris kann doch auch nichts dafür, wie das Restaurant heißt.“
„So geht das schon seit Wochen“, sagte Stefanie. „Neulich waren es die Beduinen, jetzt die Bombe hier.“
„Ich frag ja nur“, sagte Manke.
„Die Pastalikos sollen ausgezeichnet sein“, rief Doris.
„Was ist denn das?“, fragte Andrea. Es war das erste Mal in Israel, dass Bernhard ihre Stimme hörte. Andrea und Mario waren das stille Paar, sie waren all die Jahre nur dabei gewesen, damit die anderen vier sich besser fühlen konnten. In Krisenzeiten schlugen sie sich mal auf die eine, mal auf die andere Seite. Sie waren die FDP ihrer Reisegruppe.
„Pasteten mit Pinienkernen und Hackfleisch“, sagte Doris. „Außerdem brennen sie hier den Schnaps selbst.“
„Haben sie auch einheimisches Bier?“, fragte Mario.
In der Nacht träumte Bernhard davon, wie er im Roten Meer auf einen der hochgiftigen Fische trat, von denen er im Reiseführer gelesen hatte. Bekam man nicht innerhalb kurzer Zeit ein Gegengift, starb man.
Er schleppte sich aus dem Wasser, der Strand war menschenleer, nur am Ende erkannte er eine Figur. Er lief auf sie zu. Es war ein summender Mann mit einer Videokamera. Er wollte den Fuß filmen, den vergifteten Fuß.
Matze zum Frühstück und Heerscharen amerikanischer Juden, deren schlecht gelaunte Kinder sich am Buffet benahmen wie die Axt im Walde.
Ihre Mütter redeten unglaublich laut. Sie redeten nicht, sie machten Ansagen für den gesamten Frühstücksraum. Finish your milk, Zachary, Honey. Die Männer saßen daneben, still und eingeschüchtert, als habe ihnen jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen. Im Leitartikel der „Haaretz“ las Bernhard, dass christliche Pilger von orthodoxen Juden angespuckt worden waren. Außerdem gab es Streit um ein Haus illegaler jüdischer Siedler im Palästinensergebiet Ostjerusalems. Dann: rauf auf den Berg Zion, wo angeblich David begraben lag, König der Juden.
Heerscharen von russischen Juden.
In einem leeren Raum versammelten sich Stefanie, Andrea und Doris andächtig um Rainer, der aus seiner Fibel einen Bericht über das letzte Abendmahl vortrug, das hier angeblich stattgefunden hatte. Man sah nicht einmal einen Tisch. Mario saß abseits auf einer Bank und streichelte eine streunende Katze hinterm Ohr. Beim Herumirren zwischen hellen Steinmauern in der Mittagshitze traf Bernhard einen Rabbiner, der ihm vom friedlichen Zusammenleben der großen Weltreligionen vorschwärmte.
Er erzählte, dass er für das World Peace Center tätig sei. Dann beschimpfte er die katholische Kirche dafür, dass sie dem Staat Israel den Raum stehlen wollte, in dem das Abendmahl stattgefunden hatte.
Bernhard stand in der Mittagshitze und sah auf den bekleckerten Schlips des Rabbiners. Am Horizont stieg eine Rauchwolke in den wolkenlosen Himmel.
„Ostjerusalem“, sagte der Rabbiner und schüttelte den Kopf.
„Was ist denn da los?“, fragte Bernhard.
„Kompliziert“, sagte der Rabbiner. „Wir haben eine acht Meter hohe Mauer gebaut und immer noch keine Ruhe.“
Er drückte Bernhard seine Visitenkarte des World Peace Centers in die Hand, auf der eine Adresse in Bensonhurst, Brooklyn, stand. Die Karte sah aus, als habe der Rabbiner sie selbst gestaltet.
„Brooklyn?“, frage Bernhard.
„Da wohnt meine Schwägerin“, sagte der Rabbiner. Bernhard gab ihm seine Visitenkarte vom Berliner Sparkassenverband. Der Rabbiner sah sie an, steckte sie in seine Westentasche und erklärte dann den Weg zum Grab Oskar Schindlers. „Da wollen Sie doch sicher hin, oder?“
„Warum nicht“, sagte Bernhard.
Einen Augenblick lang glaubte er, einen kleinen Vorsprung zu haben. Aber als er auf dem leeren Friedhof eintraf, sah er die anderen. Sie standen an Schindlers Grab wie der Igel in „Hase und Igel“.
Bernhard erkannte schon aus der Entfernung, dass Rainer redete. Wahrscheinlich erklärte er gerade, dass Ben Kingsley einen Oscar bekommen hatte, Liam Neeson aber nicht, und dass Michel Friedmans Eltern von Schindler gerettet worden waren. Sie schienen ihn nicht zu vermissen. Bernhard Manke sah auf die Rauchwolke am Horizont und dachte an den Taxifahrer, den Yves ihnen nach Taba, dem ägyptischen Grenzort, schickten wollte, um sie zum Big Dune zu bringen. Mahud.
Die nächsten anderthalb Tage verbrachten sie am Toten Meer, wo Bernhard vorübergehend erblindete. Er hatte etwas von dem Salzwasser in die Augen bekommen, das mit seinen Kontaktlinsen irgendeine aggressive chemische Verbindung eingegangen war. Bernhard Manke trieb blind auf der Oberfläche des Salzsees, die Stimmen der anderen wurden leiser, es war nicht unangenehm. Bernhard stellte sich vor, wie er langsam ans andere Ufer trieb. Ein manövrierunfähiges deutsches U-Boot auf dem Weg nach Jordanien. Wieder eine andere Welt. Wie wütend der israelische Fremdenführer den amerikanischen Touristen über die Jordanier berichtet hatte, die in den 40er-Jahren den Platz vor der Klagemauer okkupiert hatten. Irgendwann packte ihn jemand an den Schultern und brachte ihn ans Ufer. Rainer. Natürlich Rainer. Bernhard wäre lieber von Mario gerettet worden. Er wusch sich die Augen aus und blieb im Hotelbett, während die anderen zu Exkursionen aufbrachen. Am Abend hörte er sich an, was er alles verpasst hatte. Jericho, Qumran-Schriftrollen und so weiter und so fort. Bernhard erzählte ihnen nichts von den Flugkörpern, die er aus seinem Hotelfenster beobachtet hatte. Silbrige Schatten, die mit hoher Geschwindigkeit über das Salzmeer schossen, ostwärts. Vielleicht lag es nur an seinen entzündeten Augen, vielleicht aber auch nicht. Er rechnete jeden Moment mit einer Reaktion aus dem Osten. Einer Antwort.
Mahud war nicht da, als sie nach endlosen Befragungen am Nachmittag des Karfreitags ägyptische Erde betraten. Bernhard war nicht überrascht.
„Vielleicht hat sich Yves im Tag geirrt“, sagte Doris.
„Oder im Jahr“, sagte Bernhard.
Niemand lachte, sie sahen ihn vorwurfsvoll an.
„Es sind ja wohl genug andere Taxis da“, sagte Doris und zeigte auf die lange Reihe klappriger Kleinwagen. Neben ihnen Männer in langen Kaftanen. Beduinen. Bernhard dachte an den Sportchef von dpa, aber es war zu spät, um umzukehren. In zwei, drei Stunden würde die Sonne untergehen. Es gab keinen Van. Sie mussten sich zwei Taxis teilen.
Rainer, Doris, Mario und Andrea fuhren im ersten. Steffi und er folgten im zweiten. Ihr Fahrer trug ein braunes Gewand und ein scharfgeschnittenes, schönes Gesicht.
„Big Dune“, sagte Stefanie und der Mann fuhr los. Kein Wort, kein Nicken, er fuhr einfach los. Nach fünf Minuten verloren sie das Taxi ihrer Freunde in einer Kurve. Eine Weile hoffte Bernhard noch, dass die Rücklichter aus einer Staubwolke auftauchen würden, aber irgendwann war das vorbei. Yves hatte gesagt, dass die Fahrt zum Big Dune höchstens 45 Minuten dauern würde, nach 50 Minuten räusperte sich Bernhard, nach einer Stunde fragte er: „Sind wir bald da?“, aber der Fahrer schwieg. Anfangs konnte er sich noch am Meer orientieren, das ab und zu links neben ihm aufleuchtete, aber inzwischen gab es nur noch Sand. Sie schienen ins Landesinnere zu fahren. Sie waren nun bereits anderthalb Stunden unterwegs. Die Sonne ging langsam unter, am Straßenrand lag ein totes Kamel. Vielleicht schlief es auch nur. In der Windschutzscheibe klapperten Ketten. Bernhard konzentrierte sich auf das Markenzeichen auf dem Lenkrad. Nissan. Ein westliches Logo.
Irgendetwas Vertrautes in dieser unübersichtlichen Welt.
„Müssten wir nicht langsam da sein?“, fragte Stefanie. Die Stimme brüchig, die Augen voller Angst.
„Gleich“, sagte Bernhard, griff die Hand seiner Frau und legte sie auf sein Knie. „Gleich, Liebling.“
Er stellte sich vor, wie Yves, einen Spliff hinterm Ohr, die anderen zu einer Art Matratzenlandschaft führte. Mario würde sich nach einem lokalen Bier erkundigen, Rainer nach Kameltouren zum Berg Sinai.
Irgendwann würden sie begreifen, dass sie nur noch zu viert waren.
Bernhard sah auf die Uhr. Zwei Stunden. Er lächelte Stefanie an, tätschelte ihren Handrücken. Die Beduinen spinnen. Er hatte es immer gesagt. Es war Karfreitag, bestimmte Dinge änderten sich nie.
Bernhard Manke fühlte sich nicht schlecht. Die Angst in seinem Herzen war einem seltsamen Frieden gewichen. Dem Frieden eines Mannes, der am Ende recht behalten hatte.